Homo periculans
Was prägt unser Risikoverhalten? Das Steinzeitgehirn, unsere Gene, frühe kulturelle Einflüsse, die jüngere Geschichte? Ein Versuch, dem menschlichen Risiko-Cocktail auf die Spur zu kommen.

Von David Fehr
Das Leben besteht aus Atmen, Essen, Schlafen – und Entscheidungen. Täglich treffen wir Zehntausende, zum Glück meist mit überschaubaren Folgen. Diesen oder den nächsten Bus, schwarze oder blaue Jacke, Menu eins oder Menu zwei? Andere prägen das ganze Leben. Darunter jene, die im weitesten Sinne mit Wirtschaft und Finanzen zu tun haben. BWL-Studium oder Kunsthochschule? Vermögen sparen, breit gestreut anlegen oder im Casino vermehren/verspielen? Sichere Anstellung oder eigene Ideen mit einer Firmengründung umsetzen?
Ein Blick in die Welt zeigt: Der Homo periculans – der Risikomensch, frei ins Lateinische übersetzt – beantwortet diese Fragen mit enormer Unterschiedlichkeit. Aber warum eigentlich? Welche Einflüsse prägen das individuelle Risikoverhalten? Die Spurensuche beginnt im Gehirn, dort, wo unsere Entscheidungen entstehen. Eine faszinierend leistungsfähige Maschine mit 86 Milliarden Neuronen und bis zu 100 Billionen Synapsen, die uns in den meisten Fällen gute Dienste leistet. Doch wenn es um Risikoeinschätzungen geht, versagt der Supercomputer bisweilen, so die These der evolutionären Psychologie. Sie stützt sich darauf, dass sich die physische Struktur des Gehirns in den letzten 100‘000 Jahren kaum verändert hat. Zwar kam es zu genetischen Anpassungen, doch anatomisch ähnelt es immer noch stark dem unserer Vorfahr:innen. Es ist vom Leben in der Frühzeit geprägt und tut sich schwer, alte Muster abzulegen.
Gehirn und Gene
Dass uns die evolutionäre Prägung bis heute beeinflusst, bestätigt Christian Fichter. Der Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie bewegt sich mit seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Psychologie. «Unser Gehirn ist auf schnelle intuitive Entscheidungen in unsicheren Situationen trainiert. Das war überlebenswichtig, als wir noch Jäger:innen und Sammler:innen waren», sagt Fichter. «Diese Mechanismen wirken bis heute nach, im Privat- wie im Berufsleben.» Gemeint sind Verhaltensweisen wie der Optimismus-Bias, das Überschätzen von Chancen, oder übermässige Verlustangst. Beides war in der Frühzeit wichtig, heute steht es den Menschen oft im Weg.
Dass es bezüglich Ausprägung angeborene Unterschiede gibt, zeigt eine Studie der Universität Zürich. Mithilfe von Scans konnte sie nachweisen, dass die Gehirne risikofreudiger Menschen anders arbeiten als jene der risikoscheuen Proband:innen. Insgesamt ist der Anteil der Gene jedoch gering: Laut Studie erklären sie nur gut zwei Prozent der Unterschiede beim Risikoverhalten.
Die anatomische Beschaffenheit des Gehirns und Gene spielen also eine Rolle, erklären aber nicht die enormen weltweiten Unterschiede beim Risikoverhalten. Diese sind der zweiten Einflussebene geschuldet, den kulturellen Einflüssen. Denn in den letzten 100’000 Jahren hat sich ja nicht nur ein bisschen etwas verändert. Im Gegenteil: Alles hat sich verändert.
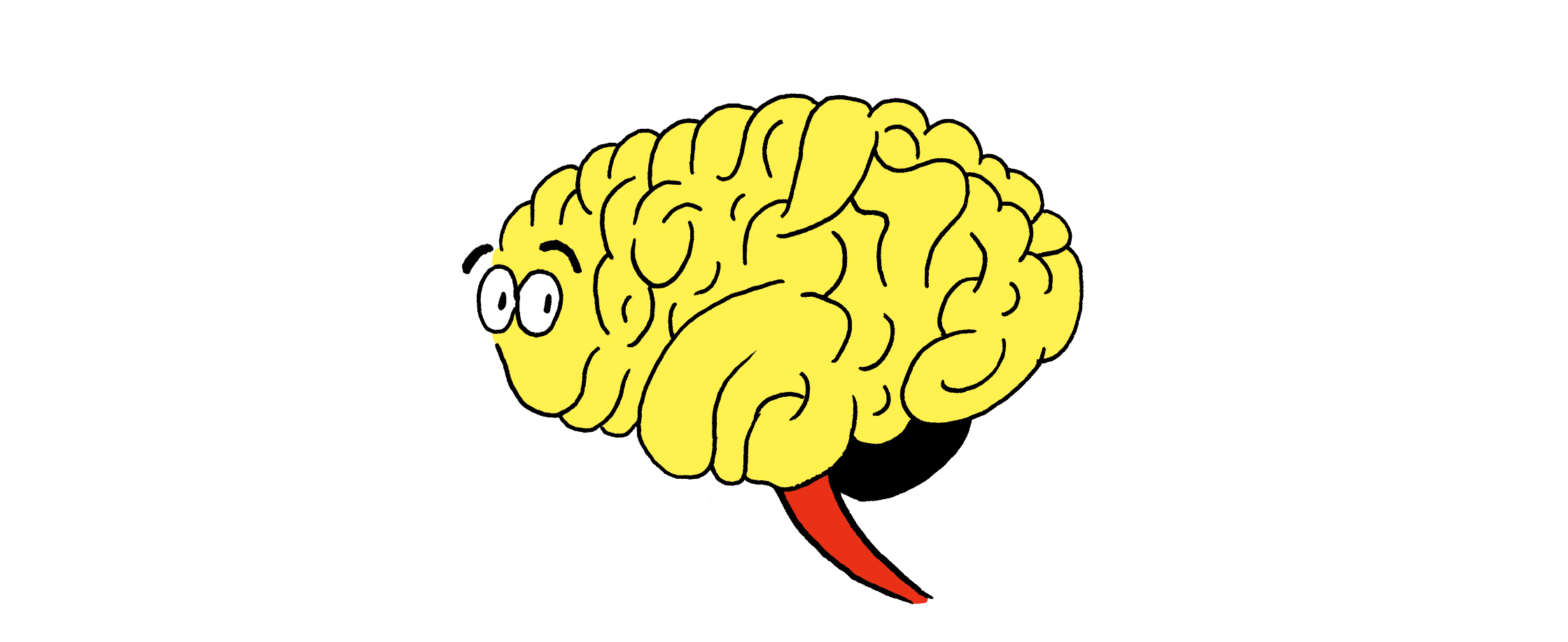
Kulturelles Potpourri
Aus Lauten wurden rund 7000 Sprachen, aus Nachdenken wurde Philosophie, Höhlenkritzeleien entwickelten sich zu Kunst. Primitive Werkzeuge wurden zu Technologie, Nomadentum zu Sesshaftigkeit und Ackerbau, Mythen und Geschichten zu Religion. Aus Baumstämmen wurden Schiffe, aus Tauschhandel Globalisierung, aus Holzstöcken atomare Sprengköpfe.
Welche Entwicklungen das Risikoverhalten prägen – und wie genau –, lässt sich nicht abschliessend bestimmen. Naheliegend ist, dass Religion und Spiritualität eine Rolle spielten und je nach Weltregion immer noch spielen. So wird risikoreiches Verhalten in stark religiös geprägten Gesellschaften oft durch klare Regeln eingedämmt. Ähnliches gilt für Kulturen, die an ein unausweichliches Schicksal glauben: Warum etwas wagen, wenn ja sowieso alles vorherbestimmt ist?
Unbestritten ist der Einfluss der wirtschaftlichen, gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen. Ausgeprägter Kapitalismus fördert mehr Risikobereitschaft als Planwirtschaft, die kaum Aufstiegschancen bietet. Fehlende Rechtssicherheit macht riskante Vorhaben noch riskanter und bremst die Innovationsfreude. Stabile politische Rahmenbedingungen erlauben mehr Risikobereitschaft, Instabilität führt zu Extremen: Entweder wird das Wenige, das man noch hat, geschützt – oder es brechen alle Dämme, und der Wagemut greift um sich.
Selbst die Sprache beeinflusst das Risikoverhalten, so eine Studie der Yale University. Je stärker sich Präsens und Futur sprachlich unterscheiden, desto ferner erscheint die Zukunft und desto mehr werden Risiken eingegangen, auch finanzieller Art.
Doch ein kultureller Rundumschlag reicht nicht, um der Risikoprägung einer bestimmten Region auf die Spur zu kommen. Sie entsteht kleinteiliger und muss auch so betrachtet werden. Worauf sich Risikokulturen begründen können, zeigen folgende Beispiele.

Japan – Harsche Bedingungen erfordern Gemeinschaft
Japans Wurzeln reichen 10’000 Jahre zurück bis in die Jōmon-Zeit. Was die Menschen von damals mit ihren Nachfahr:innen verbindet, sind die rauen Bedingungen: als Insel isoliert, Ressourcen und Ackerflächen knapp, geplagt von Hitze, Erdbeben und Tsunamis. Um zu überleben und den kargen Böden Erträge abzuringen, musste langfristig geplant und gemeinschaftlich gehandelt werden. Risiko in Form von Einzelgängertum war wenig zielführend, Kooperation umso wichtiger. «Natur und Kultur stehen in einem Wechselspiel», sagt Christian Fichter. «Die Natur gibt Umweltbedingungen vor, und die Kultur muss sich so entwickeln, dass sie mit diesen zurechtkommt, ansonsten sterben die Menschen.»
Japan ist zudem geprägt von konfuzianischen Werten wie Respekt, Harmonie und Gemeinschaft. Rituale, Hierarchien und Senioritätsprinzip sind bis heute zentral – und Glück wird weniger individuell, sondern kollektiv angestrebt. Ehre ist wichtig, Scheitern bedeutet Gesichtsverlust. Alles in allem keine Voraussetzungen für eine ausgeprägte Risikobereitschaft: Risiko wird hier meist nicht als Chance gesehen, sondern als Gefahr.
Das exakte Gegenteil sind die USA, wo Risikolust den Alltag dominiert.
USA – No Risk No Fun
Fünfzehnmal scheitern? Kein Grund, es nicht ein sechzehntes Mal zu versuchen. Vermögen, selbst jenes für die Vorsorge, wird nicht auf Sparkonten geparkt, sondern in Aktien angelegt. Oder in Bitcoin, die zu vierzig Prozent in den USA gehalten werden. Selbst beim Wohnen wird riskiert: In Regionen, die regelmässig von Hurrikans oder Waldbränden betroffen sind, wird leicht und kostengünstig gebaut – und nach Zerstörung einfach wieder aufgebaut. Auch Gesundheitswesen und Bildung sind risikobehaftet: Ein medizinischer Vorfall kann lebenslange Verschuldung bedeuten, dasselbe gilt für Studienkredite ohne späteren Top-Job.
Die USA sind Land gewordenes Risiko: Es gibt viel zu gewinnen – und ebenso viel zu verlieren. Der Grund liegt, so Fichter, in der Gründungsgeschichte. «Es ist naheliegend, dass die USA historisch vom Pioniergeist geprägt sind: Auswanderung, Goldrausch, American Dream. Die Erfahrung, dass Fortschritt oft nur über Risiko möglich ist, prägt die US-Bevölkerung.»
Die frühesten Erfolgsgeschichten lieferten die Siedler:innen: Wer sich an einem fruchtbaren Ort niederliess, konnte Reichtum aufbauen, von dem die Nachkommen bis heute profitieren. Auch in jüngerer Zeit hat sich Risikobereitschaft ausbezahlt. Etwa bei Elon Musk, der mehrfach vor der Pleite stand, alles riskierte und heute der reichste Mensch der Welt ist. Oder bei Mark Zuckerberg, der 2006 ein Facebook-Übernahmeangebot über eine Milliarde Dollar ablehnte. Heute ist er 250-facher Milliardär. Oder bei Fedex-Gründer Frederick Smith, der 1971 mit den letzten 5000 Dollar Unternehmensvermögen nach Las Vegas ging und mit Black Jack 27’000 Dollar Gewinn erzielte – über 50 Jahre später beschäftigt Fedex 500’000 Angestellte. Warum sollte man selbst nicht etwas Ähnliches erreichen?
Das Beispiel der USA zeigt zudem auf, dass eine Risikokultur nicht Tausende von Jahren benötigt, ein paar Jahrhunderte reichen. Doch die noch jüngere Geschichte könnte gemäss Fichter dafür sorgen, dass es zu einem Wandel kommt. «Mir scheint, es beginnt zu kippen. Wenn gesellschaftliche Spannungen, politische Unsicherheit und ökonomischer Druck zunehmen, wächst das Bedürfnis nach Sicherheit. Selbst Kulturen, die auf Risiko gebaut sind, können risikoavers werden.»
Risikoavers, dieses Attribut wird der Schweiz zugeschrieben. Und wie so
oft, ist das Land auch bei diesem Thema ein Sonderfall.
Schweiz – Risiko fakultativ
Eigentlich bringt die Schweiz ideale Voraussetzungen mit, die Risikofreude begünstigen: stabile Demokratie, hohe Rechtssicherheit, ein vergleichsweise sozialer Kapitalismus und wenige religiöse Einschränkungen. Dennoch dominiert das Sicherheitsdenken. «Das Phänomen heisst Verlustangst», sagt Christian Fichter: «Wer viel hat, hat viel zu verlieren. Und wer viel zu verlieren hat, schützt das Erreichte.» Stabilität habe in der Schweiz einen sehr hohen Wert – historisch, kulturell und wirtschaftlich. «Banken, Versicherungen, Sozialstaat: Alles ist auf Sicherheit ausgerichtet. Diese Haltung prägt unser kollektives Verhalten.»
Die Folge davon ist für sich genommen positiv: In der Schweiz lässt es sich auch ohne Risikobereitschaft gut leben. «Das Schweizer Modell bietet mit Ausbildung, Arbeitsmarkt und sozialer Sicherheit schon sehr gute Lebensperspektiven. Der Druck, ins Ungewisse zu springen, ist gering. Das macht die Gesellschaft insgesamt risikoavers. Und es erklärt, warum der Silicon-Valley-Mindset hier nur begrenzt Wurzeln schlägt», sagt Fichter. Und selbst wer etwas wagt und scheitert, fällt vergleichsweise weich.
Acht Milliarden Risiko-Cocktails
In Japan sind es klimatische Bedingungen und Werte, in den USA die Gründungsgeschichte, in der Schweiz der Wohlstand: Kulturelle Risikoprägung kennt verschiedene Gesichter. Doch auch sie liefert nur ein Grundrauschen, kein finales Urteil. Jede:r trägt einen eigenen Risiko-Cocktail in sich, geprägt durch Erziehung, Umfeld, persönliche Erfahrungen – und damit nicht zuletzt dem Zufall. Diese Prägung beginnt früh: «Bereits Kleinkinder haben unterschiedliches Temperament, sind unterschiedlich wagemutig. Zusammen mit Erfahrungen in der Familie und im kulturellen Kontext formen sich daraus die unterschiedlichen Arten, mit Risiken umzugehen», sagt Fichter.
Das genaue Rezept dieser über acht Milliarden Varianten bleibt ein Rätsel. Ein Rätsel, das einem zeitlebens prägt, aber nicht zwingend über das Leben bestimmen muss: «Wie alle unsere Verhaltensweisen können wir auch unsere Risikoprägung nicht einfach abstreifen», sagt Fichter. «Aber wir sind ihm auch nicht ausgeliefert. Verhalten lässt sich verändern, wenn man dazu motiviert und fähig ist. Das ist aufwändig und mühsam, kann sich aber lohnen.» Der Homo periculans mag uralte Wurzeln haben, seine Zukunft aber kann er selbst mitgestalten.
